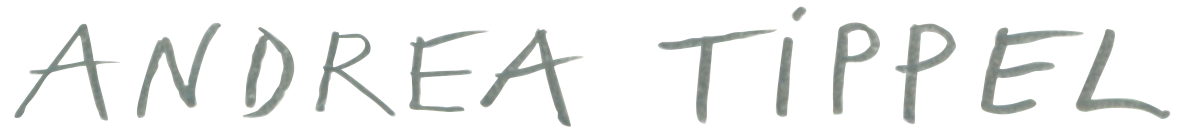Hans-Joachim Lenger
Die Diagramme der Ariadne. Zu Andrea Tippels Zeichnungen aus den
70er-Jahren
Rede von Hans-Joachim Lenger zur Ausstellungseröffnung mit Zeichnungen aus den 70er Jahren von Andrea Tippel in Galerie Melike Bilir, Hamburg, veröffentlicht in: Lerchenfeld Nr. 15, Juni 2012, HFBK Hamburg, S.23/24
Man könnte meinen, in diesen Zeichnungen wie in einem Labyrinth zu erwachen. Ohne Erinnerung daran, wie man es betreten konnte, und ohne zu wissen, wie es zu verlassen ist. Immer neu zeigen sich in ihm zwar Auswege, die dem Suchenden versprechen, ins Freie zu gelangen. Doch sobald er ihnen folgt, verwickeln sich die Hinweise nur erneut in unabsehbarer Dichte, kehren sie sich gegen sich, falten sie sich ein, gehen sie in neue Verzweigungen über oder bilden neue Schlaufen.
Woher das Wort „Labyrinth“ stammt, ist etymologisch unklar. Sicher ist nur: Einst verliebte sich Ariadne, die Tochter des kretischen Königs Minos und seiner Gattin Pasiphaë, in den Helden Theseus. Sie half ihm, ihren Halbbruder zu töten, den Minotaurus. Den hatte Dädalus, der Findige, ins kretische Labyrinth verbannt, wo er jährlich sieben Jungfrauen und Jünglinge als Tribut einforderte. Also musste Theseus ins Labyrinth hinab, um den Minotaurus zu erschlagen. Doch um dem Helden ebenso eine Rückkehr aus den labyrinthischen Windungen zu ermöglichen, gab ihm die Liebende ein magisches Wollknäuel mit auf den Weg. Und zeigte ihm, wie es zu verwenden sei: am Eingang befestigt und auf dem Gang ins Innere abgerollt, werde es ihm den Rückweg weisen.
So entkam Theseus dem Labyrinth, doch anstatt sie nach Athen heimzuführen, wie er es versprochen hatte, setzte er die liebende Frau während der Rückreise auf der Insel Naxos aus. Fragwürdigen Berichten zufolge soll Diana die Ariadne durch einen plötzlichen Tod erlöst haben. Glaubwürdiger dagegen dürfte sein, dass der Gott Dionysos sie erblickte und, von ihrer Schönheit entzückt, zu seiner Gemahlin machte. Treu, wie der Gott ihr war, erwirkte er bei Zeus, dass sie bei ihrem Tod in den Kreis der Götter aufgenommen wurde.
So weit die Geschichte der Ariadne, wie sie uns überliefert ist. So viel zu ihren Techniken, das Labyrinth zu queren, über die Liebe zu einem Mann, den sie mit ihrer Fadentechnik rettete, um von ihm verlassen zu werden. Und so viel über ihre Geschichte an der Seite eines Gottes, neben dem sie ihren Platz im Olymp einnahm. Merkwürdig genug, dennoch scheint ihr Platz überall der abseitige Ort eines Ausgangs gewesen zu sein, an dem sie auf einen Helden wartete oder von ihm verlassen wurde, an dem ein Gott sie erwählte oder erhöhte. Der Faden der Ariadne, so sieht es aus, wurde von anderen eingefädelt, die ihn bald abschneiden, bald neu entrollen.
Doch eben darin besteht das Trugbild. „Ariadne“, so vermerkt es eine der Zeichnungen Andrea Tippels, „war eine weise Strickerin“. Und ein Detail dieser Zeichnung illustriert, wie man sich diese Verstrickungen vorzustellen hat. Es zeigt einen Faden, der sich durch ein labyrinthisches Gewebe zieht, wo er sich tief in andere Fäden eingeschmiegt und innig mit ihnen verschlungen hat. Von hier aus läuft er auf ein Außen zu, um zu jenem Knäuel zu werden, aus dem er sich entrollt haben wird. Doch entrollt er sich, oder rollt er sich nicht vielmehr in dieses textile Knäuel erst hinein? Die Frage bleibt unentscheidbar. Noch der Ausgang jedenfalls ist in einen Textballen verstrickt, ist selbst Strickwerk, und kein Resultat, das aus diesem Gewebe herausführen könnte. Denn tatsächlich gibt es gar keine Ausgänge des Textes, keine Auflösungen einer Schrift. Der Platz der wartenden oder verlassenen, der gesehenen oder erhöhten Ariadne, der Platz des vermeintlichen Ausgangs ist der des Rätsels selbst, das sich immer anders entrollt und zusammenzieht, um uns in sich zu verstricken. Und die landläufige Vorstellung, einen Ausgang des Labyrinths zu weisen, bleibt selbst bloßes Trugbild, labyrinthisch wie das Gefüge, aus dem es herausführen sollte. So versetzt uns Fadentechnik, von der uns Andrea Tippels Zeichnungen sprechen, immer mitten hinein in dieses Gewirr wilder Verweise. Umso weniger kennt es eine Lösung, je sicherer wir uns eines Ausgangs wähnen. Stattdessen erwachen wir in diesen Zeichnungen immer neu – wie in einem Labyrinth.
Mit dem, was man gemeinhin eine „künstlerische Zeichnung“ nennt, haben die Arbeiten Andrea Tippels deshalb auch nur am Rande zu tun. Viel eher handelt es sich um Niederschriften eines Denkens, um Protokolle einer sich wiederholenden Frage oder um experimentelle Notationen, die ihrer Sache intim verschworen sind. In ihnen geht das Labyrinth der Zeichen immer neue Konstellationen ein, um sich befragen und erforschen zu lassen. Diese Zeichnungen „Diagramme“ zu nennen käme der Sache vielleicht am nächsten. Denn Diagramme stellen Sachverhalte in ihrem Zusammenhang dar. Sie bilden Relationen ab und Kräfteverhältnisse, Differenzen und Entsprechungen, Abstände und Übergänge, Zustände und Prozesse. Und dazu bringen sie ein mimetisches Potenzial ins Spiel, das sie den Gegenständen ebenso nahebringt wie anähnelt. In dieser Mimesis besteht zugleich die subversive Kraft des Diagramms. Wo seine Ähnlichkeiten zu wuchern beginnen, wird es den Gegenständen gleich, greift es auf diese Gegenstände über. Mimetisch schmiegt es sich ihnen ein und verschlingt sich in sie. Es verknüpft sich mit ihnen wie jener Faden der Ariadne, der ins Innere des Labyrinths führt und noch dessen Ausgang zu einem Labyrinth verknäult. Im Innern jedes Diagramms arbeiten die Maschinen einer Anagrammatik. Und erkennbar bringt dies jede heldische Ökonomie eines Resultats in Gefahr. Unversehens sieht sich der Mehrwert bedroht, der als Resultat jeder ökonomischen Operation an deren Ausgang stehen soll.
In der Regel wird das mimetische Spiel des Diagramms deshalb streng begrenzt. Erst die Verknappung seiner Zeichen hält es zu seinen Gegenständen auf Distanz, hält es arbeitsfähig oder funktional. Eine sparsam kalkulierte Ökonomie der Zeichen soll sicherstellen, dass sie vom Sachverhalt unterscheidbar bleiben, dem sich das Diagramm anähnelt. Und um es dieser ökonomisch kalkulierten Kontrolle zu unterwerfen, schreibt eine „Legende“ fest, was jedes einzelne Symbol eines Diagramms bedeutet, welche präzise Funktion es wahrnimmt, um einen Mehrwert zu erarbeiten, der am Ausgang der Operation realisiert werden soll.
Hier aber erklingt wie von fern Ariadnes Lachen. Denn was ist von einem Diagramm zu halten, das sich kalkuliert zurückhält und Diagramm deshalb nicht wird? Ein Diagramm, das diesen Namen verdient hätte, wäre Mimesis bis zum Äußersten; vorbehaltlose Mimesis; Mimesis, die sich selbst verschwendet und ihre Ökonomie verausgabt oder verschleudert; Mimesis ohne Ausgang und ohne Resultat eines Mehrwerts also, Spiel einer anarchischen Mimesis. Wie sollte man da glauben können, eine stupide „Legende“ könnte Auskunft geben über den ökonomischen Wert eines Symbols, das im Diagramm seine kalkulierte Verwendung findet? Müsste eine solche Legende nicht vor allem selbst als Diagramm geschrieben werden? Derart, dass sich der Ausgang des Labyrinths in jeder Legende selbst labyrinthisch fortschreibt? Oder sich diagrammatisch ins Labyrinth einschreibt, um es zu wiederholen, zusätzlich wuchern zu lassen, ohne einen Ausgang zu weisen?
Das Lachen, das wir vernehmen, hält sich zurück. Doch umso unbezwingbarer bleibt es. Es klingt in diesen Zeichnungen wieder, so als kündige sich in ihnen eine dionysische Askese an. „dieses hier“, schreibt Andrea Tippel über ihre Versuchsanordnung eines Wärmeaustauschs, „ist offenbar ein laboratorium der physik mit künstlichen bedingungen, denn auf die aussentemperatur, die nicht wegzunehmen ist, ist keinerlei rücksicht genommen worden, ist das denn der natürliche zustand des papiers, sobald man anfängt, drauf zu zeichnen: ein laboratorium, in dem man beliebig natürliche bedingungen ein- und ausschalten kann? warum nicht. oder: ja, genau das ists. papier, stift, kopf und hand. kopf auf papier. kopf kann ja sehr viel. hand muss es machen. kann aber oft nicht. kopf kann oft nicht. wenn kopf nicht kann und hand aber was will, dann wird immer hilflos nach dem entsprechenden gesucht, aber nicht gefunden. hand will, was kopf zu können glaubt. kopf will dann was hand dann kann. dann irgendwann verlässt sich kopf auf hand. wenn kopf hand gibt, kann man mal anfangen. wenn nicht, wird man damit warten. wenn kopf hand gegeben hat, gibt hand oft kopf. wenn hand nicht kann und kopf was will, ab ins bestellbuch. kopf bestellt bei hand. irgendwann bestellt sies. kopf und hand machen was zusammen.“ 1
Es bedarf also nicht viel, um sich ins Labyrinth zu versetzen, nicht mehr als eine Armut der Mittel. Stift und Papier, Kopf und Hand reichen schon aus. Vor allem jedoch wird eine insistierende Frage verlangt, um in jedem Ausgang eine Scheinlösung zu erkennen. Ein Lachen, das sich den begrenzten Ökonomien der Zeichen und Verweise, der Texte und Bilder nicht fügt, sondern sie sprengt, von Verweis zu Verweis. Eine wilde Freude der Niederschrift, eine diagrammatische Leidenschaft, die ihre Grapheme ebenso zerstäubt wie die Gegenstände, denen sie gewidmet sind. Dem, was wir „Kunst“ nennen mögen, ist Andrea Tippel umso näher, als sie sich nicht darum schert, was als „Kunst“ gemeinhin gelten soll: Kalküle des Schönen etwa, Ordnungen der Präsentation und Repräsentation, Rücksichten einer Zirkulation, die Gebrauchswerte an den Mann bringen will und Mehrwert realisiert. Tatsächlich aber gibt es überhaupt keinen Grund, die Dinge derart zu beschneiden, um sie brauchbar zu machen; und keinen Grund, einer Kunst-Legende zu vertrauen oder die Logik eines Textes von jener der Bilder abzugrenzen, beide in sich einzuschnüren und knapp zu halten, um sie eine „Bedeutung“ wie einen Mehrwert erarbeiten zu lassen.
Unablässig gehen beide vielmehr ineinander über, verweisen sie aufeinander, produzieren sie sich, stützen sie und inspirieren einander, verschwenden sie sich wechselseitig und gehen wilde diagrammatische Verbindungen ein, ohne sich um einen möglichen Nutzen zu scheren. Eine Diskurspolizei, die über die Verkehrsordnung der Zeichen wachen würde, sieht sich hier beschämt; der platonische Dialektiker, der ihre zweckmäßige Verfertigung überwachen will, bleibt sprachlos. Seine Appelle zu einem verantwortlichen Zeichengebrauch verhallen ungehört, seine Ökonomien idealer Bedeutung zeigen sich überfordert.
Denn stets geht möglicher Bedeutung diese Schrift voraus, die das Denken selbst erst erwachen lässt. Und umso weniger lässt es sich von Problemen der Entzifferung oder Lektüre gefangen nehmen. „Ein Kind schreibt einen Brief. Lies mir vor, sagt die Mutter. Ich kann doch noch nicht lesen, sagt das Kind.“ Ein Denkbild der Ariadne, so entziffern wir es auf der Zeichnung Andrea Tippels, die uns bereits in die Fadentechnik eingeführt hatte. Dieses Kind ist das eines Wissens, das sich nicht weiß, sondern erst zu buchstabieren anschickt. Kindlichkeit eines kommenden Wissens und das Insistieren einer Frage: Denn aus welcher Naht treten die Zeichen und die Dinge auseinander hervor? Welche Differenz teilt sie, lässt sie auseinander treten und hält sie auf Abstand? In welches Spiel der Verweisungen und Mutationen treten sie ein, um einen Ursprung zu umkreisen, der nie war und sich deshalb unausgesetzt wiederholt? Welcher Faden schließlich verknüpft sie ins Labyrinth dieser Wiederholungen? So stammelt dieses Kind und verliert sich in seine Diagramme, die seine eigene Frage nachzeichnen.
Niemanden von uns, der sie kannte und mit ihr lachen durfte, werden diese Fragen jedoch beruhigen können. Ganz im Gegenteil. Das Wissen um ihr schweres Leiden war Vorahnung eines Risses, der sich lange ankündigte. Umso weniger wird er zu schließen sein. Denn wie sollten Andrea Tippels sanfte Militanz, ihr verhaltenes Fadenspiel, die Kindlichkeit ihrer wilden Diagrammatik ersetzbar sein? Was, um es auszusprechen, könnte darüber hinweghelfen, dass sie uns fehlt? „Einer denkt, da kann nur der Tod sein, damit er denkt, da kann der Tod nicht sein. Aber es stimmt!“ lesen wir auf ihrer Zeichnung, ganz in der Nähe des schreibenden Kindes. Wo aber ist der Tod? Wie widerfährt er? Andrea Tippel zitiert hier, ohne es ausdrücklich zu machen, eine kurze Geschichte Anthony de Mellos’.
„Der Tod wartet in Samarra“ heißt sie und erzählt von einem Diener, dem auf dem Markt in Bagdad der Tod begegnet. Angsterfüllt läuft er zu seinem Herrn und bittet ihn um ein Pferd, das ihn schnell nach Samarra tragen soll, wo der Tod ja nicht ist. Der Herr gibt es ihm und geht darauf selbst zum Tod. Du hast meinem Diener bedrohliche Zeichen gemacht?, fragt er ihn. Nein, antwortet der Tod, ich war erstaunt, ihn hier in Bagdad zu treffen. Denn heute Abend bin ich doch mit ihm in Samarra verabredet. – „Die meisten Menschen haben solche Angst zu sterben“, schließt de Mello seinen Text, „dass sie ganz darauf gerichtet sind, den Tod zu vermeiden, und dabei nie richtig leben.“
Ein erbärmlicher Schluss ohne Zweifel, eine etwas verkniffene Moral, ein altväterlicher Rat, den uns der Autor da erteilt. Er richtet sich an die noch Lebenden. Für die Toten aber hat er kein Wort. „ ,ariadne war eine weise strickerin‘ “, so heißt es ganz anders in Andrea Tippels Zeichnung über den reitenden Diener, den reitenden Tod, „strickten die alten? ein großer papierfinger – ob‘s wirklich ein finger kann sein? – fährt von rechts am rand auf die gesellschaft los, zeigt fast gewaltig auf das kleine rote knäuel und das strickstück, woher kommt der? der ist beschrieben, ja, im doppelten sinn oder im dreifachen jetzt gleich: ‚einer sagt: da kann der tod nicht sein weil er denkt, da kann nur der tod sein + reitet‘ ‚und reitet‘ ist durchgestrichen, reitet er nicht?“ 2
Worauf also verweist der Finger, der da aufs Wollknäuel zeigt? Auf welchen Riss deutet er, den der Faden immer nur nachzeichnen oder umlaufen kann wie ein Symptom? Womit ist dieser Finger beschrieben, doppelt, dreifach, wenn nicht mit einer Wette, die schon eingegangen ist, wer im Labyrinth erwacht und zu leben beginnt? Handelt es sich nicht tatsächlich um eine unmögliche oder vergebliche Wette? Lässt sich der Tod etwa aufsuchen, um ihn zu vermeiden? Oder ihn meiden, um ihn vielleicht gerade deshalb anzutreffen? Was, wenn der Tod jede dieser Wetten durchschaut, sie durchkreuzt, weil er sie bereits überboten hat? Ist er nicht jedem Ort, den wir aufsuchen könnten, bereits zuvorgekommen? Wiederholt er sich nicht an jedem Platz, zu dem wir fliehen könnten? „ariadne“, lesen wir bei Andrea Tippel, „gib das eine ende deines fadens! man kommt sonst hier nicht raus. Dank allen utensilien: maschinen, papieren, lichtern, wörtern, tischen und stühlen, listen, stiften, der zeit undsoweiter, allen ungefragt-genannten. ein letztes transpon von dort nach hier dort unten rechts und hier, am 22. ersten, ,der tod hat alle leute laufen‘.“ 3
Das letzte Wort ist deshalb keines des Trostes, der Besänftigung oder gar der Hoffnung. Und genau besehen, gibt es gar kein letztes, abschließendes Wort. Am Ausgang des Labyrinths ballt sich ein Knäuel, das sich nicht entwirren lässt. Das eine, abschließende Ende des Fadens ist nicht greifbar. Es zieht sich in eine Unbegreifbarkeit zurück, um sich immer neu aus ihr zu entrollen. Als Abschied, den zu nehmen wir nicht aufhören. Und deshalb gibt es auch kein letztes Wort der Trauer, das mit ihr abschlösse. Nur ein sprachloses, ebenso erschrecktes wie lächelndes Erstaunen vielleicht, das jedem Wort vorausgeht und jenes Spiel eröffnet, in das wir uns teilen. Denn tatsächlich, Ariadne war eine weise Strickerin.
Veröffentlichung einer Rede von Hans-Joachim Lenger, Professor für Philosophie an der HFBK anlässlich der Ausstellungseröffnung „Zeichnungen von Tippel aus den 70er-Jahren“ vom 5. Mai 2012 in Hamburg. Dabei ist die Form, in der die Rede verfasst ist, ganz im Sinne der Verstorbenen kein Nachruf, sondern eine Erinnerung.
1 Andrea Tippel: Zeichnungenbeschreibungen. Teil 1. Zürich: Galerie & Edition Marlene Frei 1989, S. 49
2 Andrea Tippel: Zeichnungenbeschreibungen. Teil 1. Zürich: Galerie & Edition Marlene Frei 1989, S. 49
3 Andrea Tippel: Zeichnungenbeschreibungen. Teil 1. Zürich: Galerie & Edition Marlene Frei 1989, S. 49