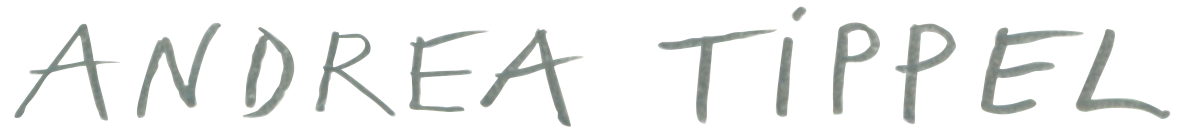Hans-Joachim Lenger
Diagramme. Zu den Zeichnungen von Andrea Tippel.
Zuerst veröffentlicht in: Lerchenfeld 03, Ausgabe Dezember 2009, herausgegeben von Hochschule für bildende Künste, Hamburg. S. 26–28. Wiederveröffentlicht als: Lenger, Hans-Joachim (2010): Diagramme/Diagrams zu den Zeichnungen von/on the drawings of ANDREA TIPPEL. Andre Behr Pamflet 2. Boekie Woekie: Amsterdam.
Ich stelle mir Andrea Tippel stets als Instrukteurin subversiver Zellen vor, als Emissärin von Aufstandsplänen, die den Aufständischen selbst rätselhaft bleiben, als Expertin kryptografischer Diagramme, die ihre eigene Entschlüsselung beständig aufschieben. Dieser verborgenen Bewegung im Untergrund scheint der Begriff des Diagramms zwar zu widerstreiten. Diagrammatisch nennt die Semiotik Peirce’ einen Zeichenmodus, in dem die Relation der Dinge ihren Ausdruck in einer ebenso relationalen Anordnung von Graphemen findet. Diagramme machen Strukturen also anschaulich. Zumeist sind sie durch ein hohes Maß an Ähnlichkeit charakterisiert, das sie zu ihren „Objekten“ aufweisen, und insofern tragen sie ikonischen, zeichnerischen Charakter. Auf nichts legen sie es jedenfalls weniger an als darauf, kryptografisch zu verbergen, was in ihnen zum Ausdruck kommt. Viel eher stellen sie Versuchsanordnungen dar, in denen und mit denen sich operieren lässt; wie Peirce erklärt: „Tatsächlich besteht genau darin der Vorteil von Diagrammen im Allgemeinen. Man kann nämlich mit Diagrammen genaue Experimente anstellen und dabei auf unbeabsichtigte Veränderungen achten, die in den Relationen der verschiedenen Teile der Diagramme zueinander herbeigeführt wurden.“ (Peirce 2000, S. 76f.)
Experimente
Kein Diagramm verdoppelt deshalb einfach, worauf es verweist. In der Regel führt es vielmehr eine Verknappung ein. Das Diagramm eines Moleküls etwa, sein chemischer Bauplan, lässt viele Einzelheiten einer molekularen Struktur aus. Es zeichnet die elementaren Strukturen nach, in denen sich die Atome konfigurieren, und macht auf diese Weise nachvollziehbar oder absehbar, wie sie sich im Augenblick einer chemischen Reaktion neu gruppieren können. Damit wird das Diagramm Medium der Forschung, wie es zugleich ihr Gegenstand ist. Oder, wie Peirce das am Beispiel einer militärischen Karte illustriert: Sie ist unverzichtbar, selbst wenn einem das Land, das sie kartografiert, direkt vor Augen liegt. Die Karte nämlich zeichnet das Gefüge der Kräfte nach, die sich im Konflikt befinden; sie lässt hervortreten, wie diese Kräfte aufeinander einwirken; sie ist Niederschrift von Virtualitäten, die sich unversehens in anderen Aktualitäten, einer neuen „Lage“ Ausdruck verschaffen können. Und im gleichen Maß, in dem sie derart in die Tiefe der Kräfte, ihrer Parallelogramme und Konjektionen einführt, versetzt die Karte das Reale, Virtuelle und Experimentelle in unauflösbare Beziehungen. Um diese Beziehungen jedoch als „Gedankendiagramm“ niederschreiben zu können, bedarf es nicht nur einer Frage, die sich an den „Gegenstand“ richtet. Die Frage muss aus dem Gegenstand selbst schon hervorgegangen sein, sie muss sich aufgedrängt haben, explizieren und als unabweisbar in einem Diagramm niederschlagen. Und deshalb bedarf es, um sie aufzeichnen zu können, bereits zeichnerischer Voraussetzungen, wie Peirce notiert: „Wir wollen unser Diagramm auf eine bestimmte Seite eines bestimmten Blatts Papier oder Pappe, das für diesen Zweck geeignet ist, skribieren – d. h. schreiben oder zeichnen oder teilweise schreiben und teilweise zeichnen.“ (ebd., S. 88) Kurz, wir treten in einen Forschungsprozess ein, der die Grenzen von Schreiben und Zeichnen, „Wissen“ und „Kunst“ bereits porös werden ließ. Nicht von ungefähr kümmert sich Andrea Tippel deshalb auch herzlich wenig um das, was die Bezirke des „Wissens“ angeblich von denen der „Kunst“ unterscheidet. Ebenso wenig schert sie sich um eine Begrenzung des symbolischen Materials, das sie in ihre Diagramme einführt. Wo solche Gesetze der Sparsamkeit und des Kalküls ihr Regime errichtet haben, da hat man es immer mit einer schon domestizierten, in sich erschöpften Frage zu tun. Die Intensität der Zeichnung dagegen rührt aus der Ungeschütztheit, in der sie die Frage aufnimmt, sich ihr exponiert und dabei unausgesetzt neues Symbolmaterial hervorbringt, um es zu anderen Diagrammen zu verketten. Sollte der Terminus des „Neuen“ überhaupt einen Sinn haben, dann am Ort dieser Ungeschütztheit.
Kryptogramme
Dies aber wirft zugleich ein Problem auf. Tatsächlich sind Diagramme in der Regel zweckgebunden. Ob in der Chemie oder im Krieg: Das Interesse, dem sie gelten, ist begrenzt. Ebenso begrenzt ist deshalb auch der „Zeichenumfang“, den sie ins Spiel bringen, und nicht weniger konventionell der semiotische Vorrat, aus dem sie ihn beziehen. Was man dagegen „Kunst“ nennt oder „Philosophie“, hat keinen besonderen Gegenstand, sondern den „allgemeinsten“. Beständig ufert er aus, teilt und vervielfacht er seine Zentren, zerreißt er vor allem seine eigene „Allgemeinheit“. Nicht einmal die Trennung in gegenständliche Bezirke wie „Kunst“ oder „Philosophie“ lässt sich hier noch aufrechterhalten, und mit „Gegenständen“ hat man es ebenso wenig zu tun. Welches Symboluniversum also könnte dies aufzeichnen? In welchem Diagramm ließe sich niederschreiben, was der semiotischen Ordnung der Wörter, der ontologischen Ordnung der Dinge vorangeht? Wie etwa wäre die „Naht“ zu denken, die beide ebenso verbindet wie trennt? Oder, anders gefragt: Welchen Sinn nimmt das diá eines „Hindurch“, welchen das grámma der Schrift oder des Zeichnens hier an? Tatsächlich geben sich Andrea Tippels Diagramme einem raschen Blick umso weniger preis, erschöpfen sich ihre Zeichnungen nie in einem flüchtigen Effekt. Unablässig bleiben sie ihrer Frage treu; die Aufstandspläne bleiben dem einfachen Blick unentzifferbar: Unausgesetzt erzeugen sie sich vielmehr selbst als Problem. Kryptisch werden sie lediglich und im gleichen Maß, in dem sie die Frage durchsichtig machen, äußerste Transparenz und Klarheit herstellen, und kryptografisch, indem sie dieser Reinheit Dauer verleihen. Nichts ist diesen Zeichnungen deshalb so fremd wie der Salon, der längst auch in der Kunst seine Diktatur schamloser Gefälligkeiten errichtet hat. Was Peirce nämlich von den unbeabsichtigten Veränderungen sagt, die sich in den Relationen der verschiedenen Teile der Diagramme ergeben, ist diesen stumpfen Regimes des Offensichtlichen geradezu entgegengesetzt. Oder auch: Was sich in den Zeichnungen Andrea Tippels niederschreibt, ist keine schöne Form; es registriert Denkereignisse.
Nicht, dass sie sich allein im „Medium der Kunst“ niederschlagen würden; ebenso wenig finden sie in irgendeiner „Philosophie“ ihr privilegiertes Terrain. Von einem Denkereignis lässt sich lediglich sagen, dass es sich skribiert und zeichnet, und von seinen Niederschriften, dass sie nur mit ihrer eigenen Virtualität zu tun haben, indem sie sich verzweigen, wiederholen und deshalb Neues hervorbringen. Der okzidentalen epistéme ist dies im Übrigen von Anbeginn vertraut. Genauer gesagt: Wo sie sich fragt, was den mýthos vom lógos, das Bild von der Idee, die Kunst vom Wissen abhebt, stößt sie auf einen Riss im symbolischen Universum, der sich dann jeder Diagrammatik mitgeteilt haben wird. Als Unruhe: In ihr zeichnet sich ab, was allemal Aufstände ankündigt.
Fremdsprachen
Denn offenbar, so erläutert es uns Platon, ist es eine Sache bloßer Vereinbarung, ob man einen Baum nun „Baum“ nennt oder mit einem anderen Sprachzeichen belegt. Das Zeichen nämlich bleibt dem Baumding äußerlich; bloße Willkür legt es fest. Diese platonische Auskunft jedoch, die im Übrigen bis heute noch Gültigkeit beansprucht, war von Anbeginn ebenso Ausgangspunkt einer tiefen Beunruhigung. Denn wenn die Beziehungen zwischen den Worten und den Dingen willkürlich, zufällig oder „arbiträr“ sind, dann ist es auch die Beziehung zur Welt. Dann ist sie nicht weniger willkürlich oder zufällig, und jeder Anspruch auf ein Wissen, jeder lógos wäre in elementarer Weise bedroht. Folgerichtig sieht Sokrates sich genötigt, etymologische Abwege zu betreten. Nunmehr fragt er nach der „natürlichen Richtigkeit“ der Worte; schickt er sich an, den Ort aufzusuchen, an dem Worte und Dinge sich ursprünglich miteinander durchdrungen haben, mehr noch: auseinander hervorgegangen sein müssen. Nicht anders nämlich könnte die Welt zur „Gewissheit“ werden. Notwendig erfasst den Sokrates deshalb aber auch eine manía, geht er in eine Art anagrammatischer Raserei über. Worte und Dinge müssen einander ähnlich werden bis zur Ununterscheidbarkeit. Nur als gleichursprünglich verweisen sie unlösbar aufeinander; nur im anagrammatischen Spiel, das den verborgenen Sinn der Worte im Datenprocessing von Buchstabenverschiebungen freilegt, wird die Spur des Wortkünstlers, jenes Gesetzgebers nämlich, entzifferbar werden, der die Worte in ursprünglicher Richtigkeit verfertigte. Das etymologische Spiel, die anagrammatische Besessenheit ist insofern aber kein magisches Spiel, kein Rasen bloßer Unvernunft. Es ist, was sich im okzidentalen Wissen beständig aufgeschoben hat: einer Reserve gleich, die nie ins Spiel kommen darf, doch stets schon im Spiel war, um vernünftig sprechen zu lassen. Nicht, dass dieses Spiel der Anagramme den Ursprung antreffen, die Spur jener Naht manifest machen könnte, die Worte und Dinge untrennbar aufeinander verweist. An einem bestimmten Punkt nämlich brechen auch die Etymologien ab, stürzen sie ins Unlesbare, erschöpfen sich sogar die Anagramme – doch nur, um das Barbarische hervortreten zu lassen. Denn wo die weitere Nachforschung aussetzt, wird man sich mit Sokrates nur noch mit der Auskunft behelfen können, ein unverständliches sei zunächst „ein barbarisches und ausländisches Wort. Und vielleicht ist manches unter diesen in der Tat ein solches; es kann aber auch von ihrem Alter herrühren, dass die ersten Worte uns unerforschlich sind. Denn da die Worte so nach allen Seiten herumgedreht werden, wäre es wohl nicht zu verwundern, wenn sich die alte Sprache zu der jetzigen nicht anders verhielte als eine barbarische.“ (Platon 1984, S. 162f.)
Philo-Ars
Diagramme, Kryptogramme, Anagramme: In den Zeichnungen Andrea Tippels umkreisen sie diese Barbarei. Sie zeitigt im Innern der „Kunst“ nicht anders als im „Denken“ unablässige Wiederholungen. Nicht, dass die barbarische Sprache je hervortreten würde; ungleich subtiler, genügt es ihr, die semiotischen Ordnungen zu erschüttern, die sich über ihr errichten wollen: Diskurse der Ökonomie und des Spiels, der Begriffe, Dinge und Bilder, des Kalküls und der Verausgabung. Denn nichts, so plaudern es die Zeichnungen Andrea Tippels im anarchischen Gestus fröhlicher Wissenschaft aus, wird das Spiel der Anagramme auf ein lautliches Material oder das der Buchstaben zu begrenzen erlauben. Hat es nicht längst auf die Bilder übergegriffen, die im Innern der semiotischen Ordnungen wirksam sind, hat es nicht stets schon die Dinge und deren Relationen erfasst? Durchquert es nicht ebenso die Welt der Zahlen und Formeln, der naturwissenschaftlichen Anordnungen, die Welt des Menschen, das Maß der Erde? Natürlich, Andrea Tippel sagt all dies ungleich einfacher und besser. Sie will nur wissen, was hier los ist. Deshalb zeichnet sie. So einfach stellen sich die Dinge nämlich dar, wo Aufstandspläne zugestellt werden. In ihnen schreibt sich lediglich nieder, was die Diagramme zum Tanzen bringt, was es den Worten und Dingen, den Zeichen und Zeichnungen, Himmel und Erde erlauben wird, in neue Konstellationen einzutreten und einem anderen Wissen Raum zu geben. Im Diagramm einer Philo-Ars kündigt sich dieses Wissen im Übrigen schon an, und Andrea Tippel hat dessen Konturen mit äußerster Präzision bereits scribiert. Die imposante Bibliothek ihrer „Library“, die diesem Wissen gewidmet ist und ihm Raum geben soll, indem sie es ausstellt, erinnert zwar an das Archiv einer Universität, ihr Bibliothekskatalog an ein Textuniversum, das alles ins Eine wenden wird. Alle diese Werke nämlich sollen erst zu schreiben sein, teilt uns die Kriegslist der Instrukteurin mit, ganz so, als wären wir nicht längst Zeugen und Autoren dieser Niederschrift. Tatsächlich enthält die Bibliothek noch kein einziges Wort, nicht einen Satz. Sie ist leer und wird es bleiben. Ihre Diagrammatik spricht allein von der Unruhe, von der sie durchquert wird. Denn ließe sich das „Sein“ nur als das Eine denken, in das universitär alles zu wenden wäre, dann umso vorbehaltloser als Leere, die keine Sammlung, sondern lediglich Alteritäten kennt und Wiederholungen durchläuft. Oder auch: Wenn die Ordnung des Zeichens, die Diagrammatik des Zeichnens, die Kryptografien und Anagramme der Wörter und Dinge im Innersten nur die Barbarei des Unverständlichen wiederholen, dann gibt nicht das Eine das Gesetz, sondern die Unverfügbarkeit des Abstands oder das Ethos des Spiels, das sich in den Zeichnungen längst zuträgt. Kein Aufstand wird deshalb final sein. Er ist immer. Überall. Und deshalb, tatsächlich, ich stelle mir Andrea Tippel als Instrukteurin subversiver Zellen vor, als Expertin kryptografischer Diagramme, die sich in ihren Zeichnungen längst zustellen.
Literatur
Peirce, Charles Sanders (2000): Gedanken und
Denkereignis, in: Semiotische Schriften, Bd. 3, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Platon (1984): Kratylos, 421d, Sämtliche Werke 2, Hamburg: Rowohlt.